Warum deine Frequenz nicht entscheidet, was du manifestierst

In der Welt von Coaching und Manifestation stolpert man irgendwann unweigerlich über diese Sätze, die so klingen, als wären sie Naturgesetze: Du musst deine Frequenz erhöhen. Du musst in die richtige Schwingung kommen. Du musst „den Zustand halten“.
Und dann kommt meistens noch so ein kleiner, scheinbar unschuldiger Zusatz hinterher, der bei mir zuverlässig denselben Effekt hat wie ein Wecker am Sonntagmorgen: am besten 21 Tage am Stück.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bei „21 Tage am Stück“ innerlich sofort zwei Stimmen. Die eine sagt: „Okay, kriegst du hin, reiß dich zusammen.“ Und die andere sagt: „Super, jetzt muss ich also auch noch mein Leben wie einen Adventskalender durchziehen, sonst bin ich nicht spirituell genug.“
Und genau da fängt es an, dass ich nicht mehr in irgendeiner Schwingung bin, sondern in einem sehr speziellen Zustand: leicht angespannt, leicht trotzig, und mit dem ganz starken Impuls, es sofort wieder lassen zu wollen.
Nicht weil ich nicht an Veränderung glaube – im Gegenteil.
Sondern weil ich aus Erfahrung weiß: Wenn etwas als Pflicht in mein Leben kommt, komme ich selbst oft nicht mehr richtig vor. Ich habe tatsächlich so ziemlich alles ausprobiert, was mit „Frequenz“, „Einstellung“, „State“ und „Alignment“ zu tun hat. Affirmationen, Visualisierungen, geführte Meditationen, Journals in allen denkbaren Farben (ja, auch diese wunderschön gestalteten, bei denen man schon beim Anfassen denkt, jetzt wird das Leben automatisch geordnet), Programme, Challenges, Morgenroutinen, Abendroutinen, Dankbarkeitstagebücher, Manifestations-Workbooks, das ganze Sortiment.
Und ich will das gar nicht lächerlich machen, wirklich nicht – vieles davon ist sinnvoll, manches ist sogar richtig schön.
Aber für mich war es oft so: Der Moment, in dem daraus ein „Ich muss das jetzt 21 Tage durchziehen“ wurde, hat mir mehr Druck gemacht als mein kompletter Terminkalender. Ich habe dann nicht mehr „manifestiert“, ich habe mich verwaltet. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dieses leise innere „Oh Gott, wenn ich jetzt einmal aussetze, dann war alles umsonst“.
Als würde das Universum mit einer Strichliste dasitzen und sagen: „Aha. Tag 8 verpasst. Pech gehabt. Komm wieder, wenn du es ernst meinst.“ Und ja, ich weiß, wie absurd das klingt – aber genau so fühlt es sich manchmal an, wenn man diese Regeln zu wörtlich nimmt.
Das Ergebnis war bei mir ziemlich verlässlich: Nach drei bis sieben Tagen war Schluss. Nicht, weil ich es nicht wollte. Nicht, weil ich „zu schwach“ wäre. Sondern weil mein Alltag so nicht funktioniert. Weil Leben nicht in 21-Tage-Blöcken passiert. Weil Termine dazwischenkommen, weil Stimmung dazwischenkommt, weil mal jemand krank ist, weil man schlicht erschöpft ist, weil man manchmal morgens aufsteht und nicht das Gefühl hat, gleich als erstes „hochzuschwingen“, sondern eher das Gefühl, man braucht erstmal Kaffee und fünf Minuten, um überhaupt im eigenen Körper anzukommen.
Und dann sitzt man da und denkt: Na gut… dann war ich wohl wieder in der falschen Frequenz. Und das ist der Punkt, an dem dieses ganze Thema gefährlich kippen kann, weil plötzlich nicht mehr die Methode das Problem ist, sondern man selbst. Man beginnt, sich zu misstrauen. Nicht dem Leben, nicht dem Weg – sich selbst. Man hat schnell das Gefühl, man sei irgendwie falsch gebaut für diese Art von Spiritualität.
Und ich kann dir sagen: Ich habe das wirklich lange geglaubt. Ich dachte jahrelang, es liegt an mir. Ich bin zu inkonsequent, zu „realistisch“, zu wenig diszipliniert, zu wenig „in meiner Mitte“. Und während alle anderen scheinbar morgens aus dem Bett schweben und dabei noch ihre Frequenz einstellen, stolpere ich halt erstmal in die Küche. Mein Mann hat das Ganze übrigens über die Jahre mit einer Mischung aus Liebe und trockenem Humor begleitet. Er hat oft gelacht, wenn wieder ein neues Journal ins Haus geflattert kam und ich mit leuchtenden Augen sagte: „Dieses Mal ziehe ich es durch.“ Und ich habe es jedes Mal ernst gemeint. Jedes Mal. Wirklich. Es war ja nicht so, dass ich mich selbst belogen hätte. Ich war überzeugt davon, dass ich jetzt endlich dieses eine Journal gefunden habe, dieses eine System, das mich „durchzieht“. Dass ich es dann doch nicht tat, war keine Schwäche. Es war einfach nicht ich. Nicht mein Rhythmus. Nicht meine Art. Und das sage ich heute mit viel mehr Freundlichkeit als früher.
Früher hätte ich gesagt: „Ich kriege es nicht hin.“
Heute sage ich: „Das passt nicht zu mir.“
Das ist ein riesiger Unterschied. Denn wenn etwas nicht zu mir passt, muss ich mich nicht schlechter machen – ich muss nur etwas finden, das wirklich mit mir geht. Und genau an diesem Punkt hat sich etwas gedreht. Bei mir wird, wie ich inzwischen gern sage, der Schuh umgekehrt draus.
Ich habe irgendwann begriffen: Für mich entsteht Veränderung nicht dadurch, dass ich mich erst in einen perfekten inneren Zustand bringe und dann endlich „würdig“ werde, etwas zu empfangen. Bei mir entsteht Veränderung dadurch, dass ich handle – und dann erlebe, dass mein Handeln Wirkung hat. Und dieses Erleben hat einen Namen, den man nicht so oft hört wie Selbstwert oder Selbstbewusstsein, obwohl er in meinen Augen mindestens genauso wichtig ist: Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit ist nicht der Satz „Ich bin gut genug“. Selbstwirksamkeit ist der Moment, in dem du spürst: „Ich kann etwas bewegen.“
Nicht im Kopf, nicht als Ideologie, sondern als reale Erfahrung im Alltag. Ich tue etwas, und danach ist etwas anders. Ich beginne etwas, und es findet einen Abschluss. Ich wage einen Schritt, und ich stehe plötzlich weiter vorne als gestern.
Und aus genau diesem Erleben wächst etwas, das man nicht erzwingen kann: Vertrauen. Nicht dieses künstliche „Ich vertraue jetzt mal“, das man sich wie eine Affirmation an die Stirn klebt, sondern dieses ruhige, organische Vertrauen, das entsteht, wenn man merkt: Ich funktioniere. Nicht perfekt. Nicht immer gleich. Aber ich kann mich auf mich verlassen.
Im letzten Blogbeitrag habe ich euch ja von meinem umgedrehten Kalender erzählt, meinem Reverse Planning. Viele Manifestationscoaches würden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil es so gar nicht in dieses klassische Bild passt: Erst planen, dann ausführen, dann beurteilen, ob du „gut“ warst. Ich mache es für mich genau andersherum.
Natürlich habe auch ich Termine, die ich einhalten muss, und das tue ich auch. Ich lebe ja nicht im luftleeren Raum. Aber alles drumherum entsteht aus meinem Tun. Aus dem, was passiert. Aus dem, wofür ich mich entscheide. Aus dem, was ich wirklich mache – nicht aus dem, was ich mir am Vorabend als perfekte Version von mir selbst ausgedacht habe.
Und ich kann ehrlich sagen: In den letzten drei Monaten ist bei mir damit mehr in Bewegung gekommen als in all den Jahren des Journalens davor. Wirklich. Nicht, weil ich plötzlich zu einer anderen Person geworden wäre. Sondern weil ich aufgehört habe, mich in etwas hinein zu prügeln, das sich für mich wie ein Korsett anfühlt. In den letzten drei Monaten ist so viel passiert. Noch ist nicht alles perfekt – und das ist auch nicht das Ziel.
Aber ich sehe endlich wieder einen Weg, und vor allem: Ich gehe ihn, ohne mich jeden zweiten Tag dafür zu bestrafen, dass ich irgendwo „nicht durchgezogen“ habe.
Und hier kommt etwas, das ich inzwischen wirklich spannend finde: Diese viel beschworenen Morgenroutinen stellen sich irgendwann von ganz allein ein, wenn man aufhört, sie als Pflicht zu behandeln. Ich meine diese typischen Pläne, die man überall liest: aufstehen, Bad, dann eine halbe Stunde Sonnengruß, danach Meditation, danach Journaling, danach Zitronenwasser, danach irgendein Superfood, und wenn man das nicht macht, ist der Tag energetisch schon verloren. Allein zu wissen, dass nach dem Bad jetzt erstmal der Sonnengruß kommen muss, hat mir manchmal schon die Laune verdorben. Nicht, weil ich Bewegung nicht mag – ich mag Bewegung sehr. Sondern weil dieses „Du musst jetzt“ bei mir eine innere Tür schließt.
Heute ist es anders.
Heute merke ich: Routinen entstehen, wenn sie wirklich zu mir passen. Mal ist es Stille. Mal ist es eine Tasse Kaffee und aus dem Fenster schauen. Mal ist es tatsächlich Bewegung – aber weil mein Körper danach ruft, nicht weil ein Konzept es verlangt. Mal ist es ein kurzer Moment, in dem ich mich frage: Was brauche ich heute wirklich? Und wenn du mich fragst, ist das die ehrlichste „Morgenroutine“, die ich kenne: nicht das gleiche Programm jeden Tag, sondern die Bereitschaft, sich selbst zu begegnen. Ohne Zwang. Ohne „wenn du das heute nicht machst, bist du raus“. Affirmationen können helfen, ja. Meditationen können helfen, ja. Ich will das überhaupt nicht vom Tisch wischen. Sie können beruhigen, sie können klären, sie können dich erinnern, wenn du dich verloren hast. Sie können wie ein sanftes Licht sein, das wieder angeht. Aber sie sind nicht ausschlaggebend. Sie sind nicht der Motor. Sie sind eher wie das Stimmen eines Instruments. Und das ist wertvoll. Aber spielen musst du trotzdem selbst. Und dieses Spielen beginnt nicht bei der Frequenz, sondern bei der Bewegung.
Bei dem Schritt, den du wirklich gehst. Bei dem Anruf, den du wirklich machst. Bei dem Gespräch, das du wirklich führst. Bei dem Ding, das du wirklich abschließt. Bei dem Mut, der nicht daraus entsteht, dass du dich erst perfekt fühlst, sondern daraus, dass du dich trotzdem bewegst. Vielleicht ist es also gar nicht deine Frequenz. Vielleicht ist es nicht so, dass du „falsch schwingst“. Vielleicht ist es eher so, dass du jahrelang versucht hast, dich in ein System zu pressen, das nicht deins ist. Und vielleicht liegt die eigentliche Erleichterung nicht darin, endlich die „richtige“ Frequenz zu finden, sondern darin, aufzuhören, dich selbst wie ein Radio behandeln zu müssen.
Ich habe früher wirklich gedacht, Manifestation bedeutet: Ich stelle mich richtig ein, dann passiert etwas.
Heute fühlt es sich eher so an: Ich erlaube mir, wirksam zu sein, und daraus entsteht etwas. Ich handle, ich lerne, ich korrigiere, ich gehe weiter. Und ja, ich bin dabei nicht immer strahlend, nicht immer hochschwingend, nicht immer in meiner Mitte. Manchmal bin ich müde. Manchmal bin ich genervt. Manchmal bin ich ganz normal. Und trotzdem passiert etwas, weil ich mich nicht mehr davon abhängig mache, wie perfekt ich mich innerlich „fühle“, bevor ich losgehe.
In den letzten drei Monaten habe ich mehr erreicht als mit all dem Journalen in den letzten Jahren. Und das schreibe ich nicht, um Journals schlecht zu machen. Ich schreibe es, weil ich weiß, wie viele Menschen da draußen sich heimlich fragen, warum es bei ihnen nicht klappt. Warum alle anderen scheinbar „manifestieren“, während man selbst wieder an Tag fünf scheitert und sich dann auch noch schlecht fühlt.
Wenn du dich darin wiedererkennst, dann möchte ich dir wirklich sagen: Vielleicht ist das keine Schwäche. Vielleicht bist du nicht falsch. Vielleicht brauchst du nicht die richtige Frequenz. Vielleicht brauchst du etwas, das zu dir passt. Und vielleicht wird bei dir – so wie bei mir – der Schuh umgekehrt draus. Weg vom Zwang, weg vom „durchziehen müssen“, weg vom Gefühl, du müsstest erst jemand anders sein, um dein Leben bewegen zu dürfen. Hin zu Selbstwirksamkeit. Hin zu diesem ruhigen Vertrauen, das nicht aus Technik entsteht, sondern aus Erfahrung. Und wenn dann am Ende des Tages nicht ein perfekt ausgefülltes Journal da liegt, sondern viele rote Häkchen hinter dem, was wirklich getan wurde, dann ist das vielleicht keine weniger spirituelle Version deines Weges – sondern genau deine. Und manchmal ist genau das die Frequenz, die zählt: die eigene. Nicht als Zustand, den du halten musst, sondern als Wahrheit, in der du dich endlich wiedererkennst.
Von Herzen Runa
Zurück

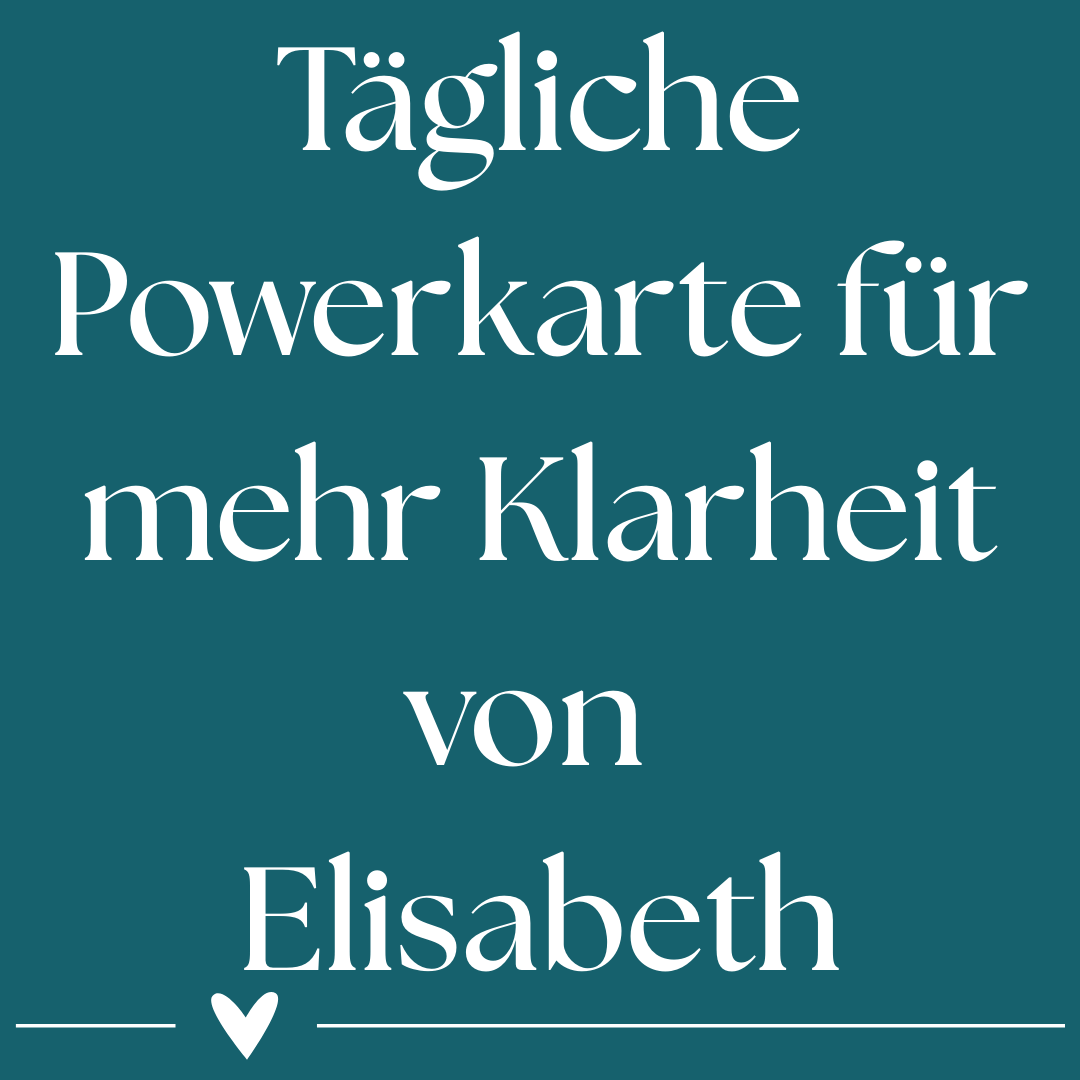
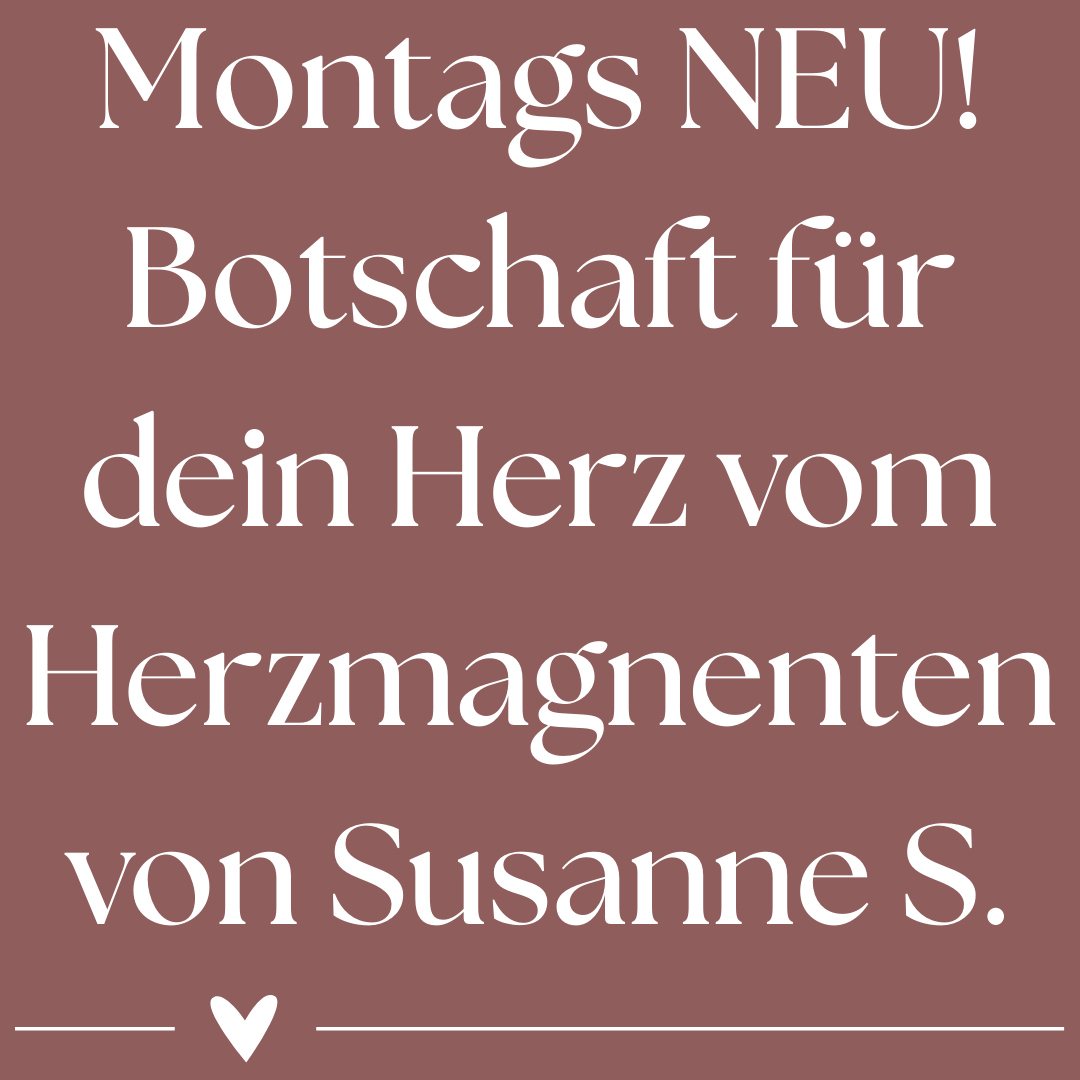

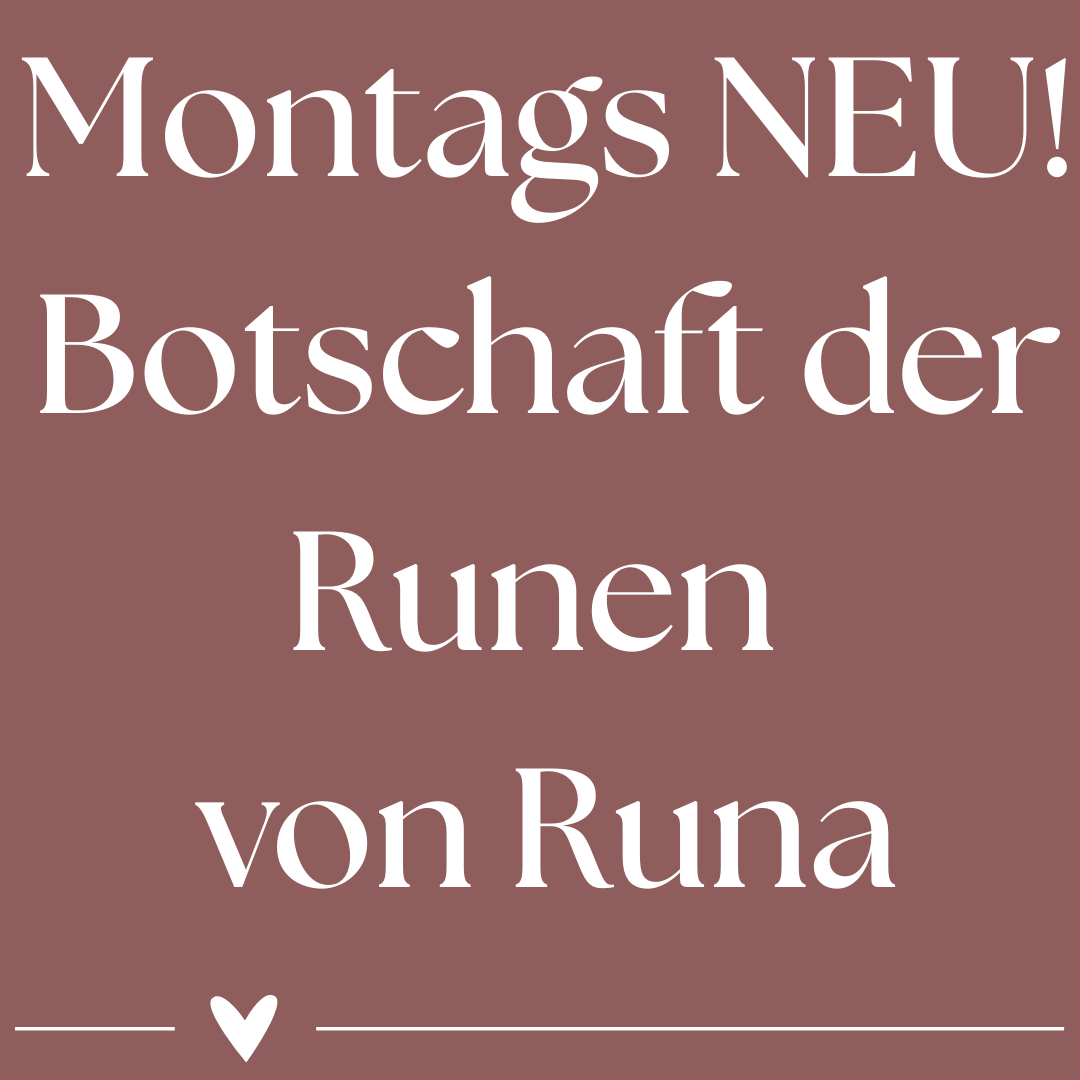

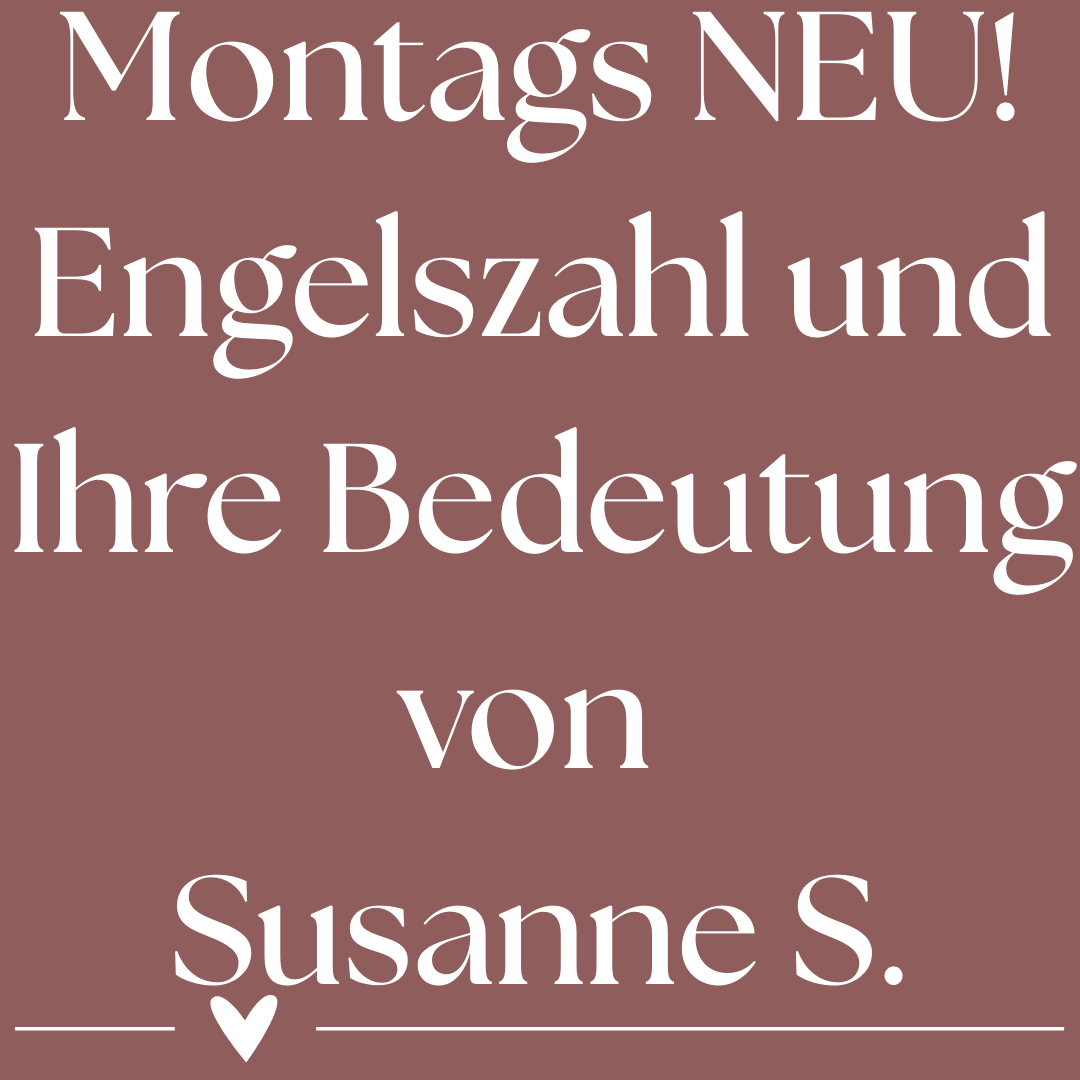
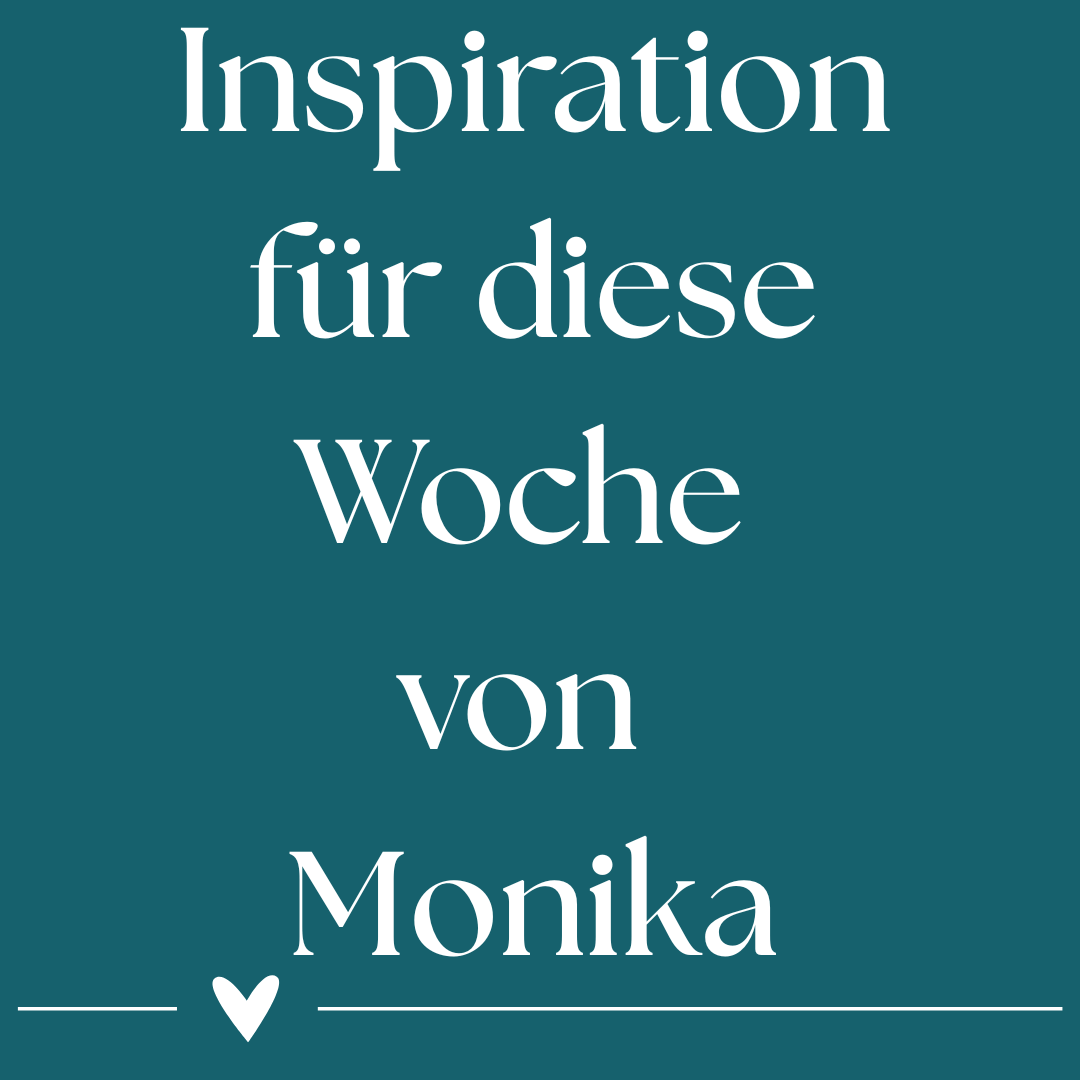

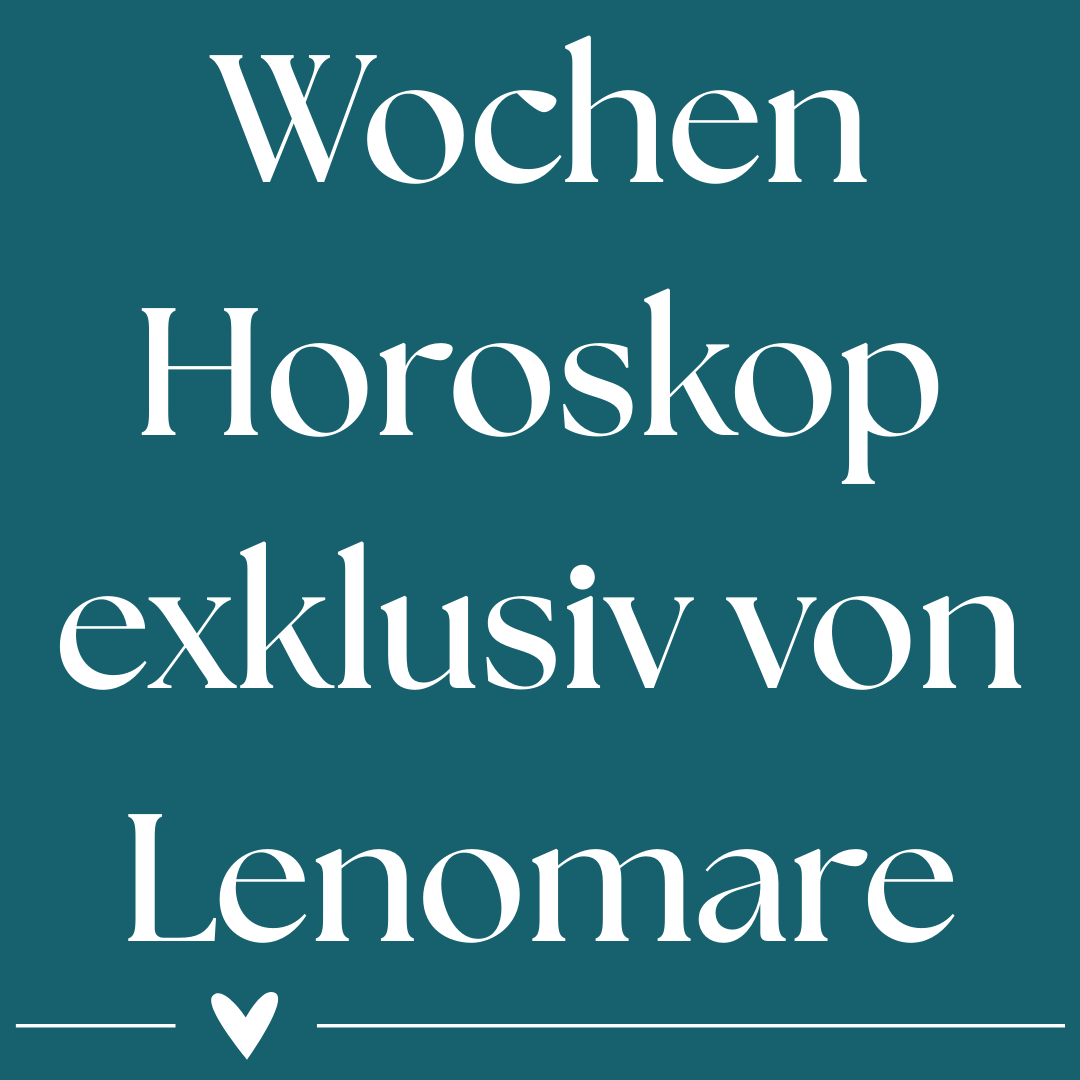
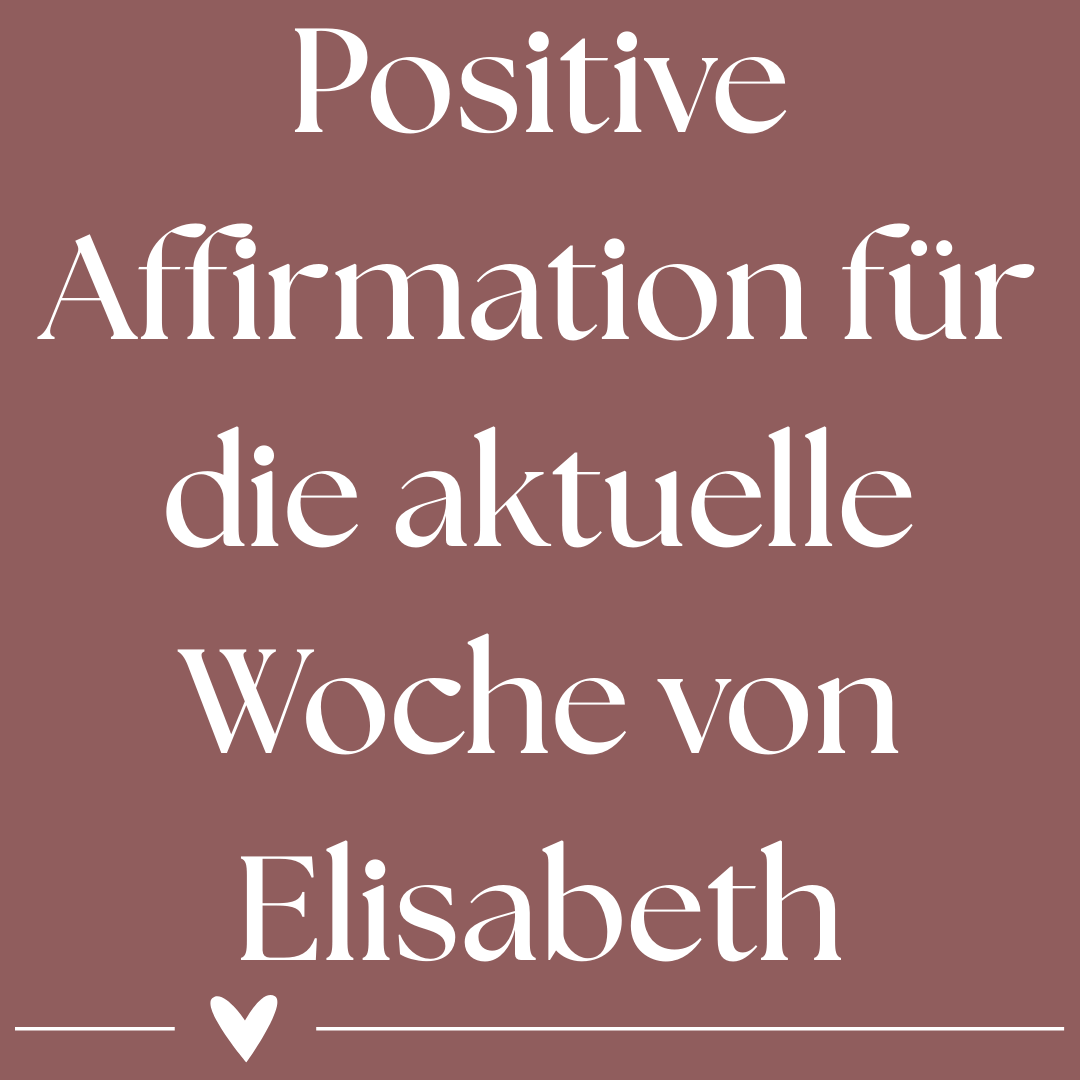








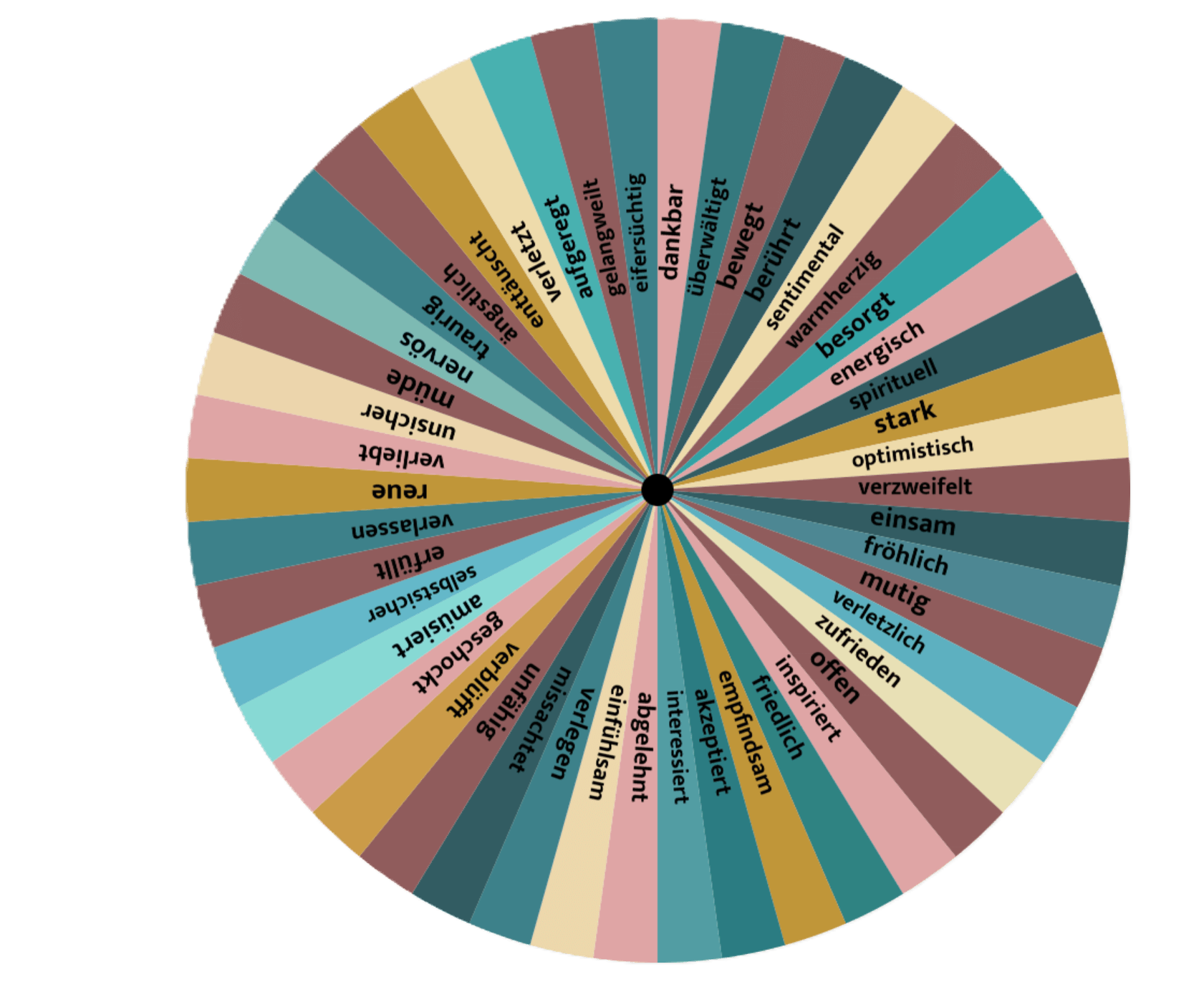










































































Kommentare